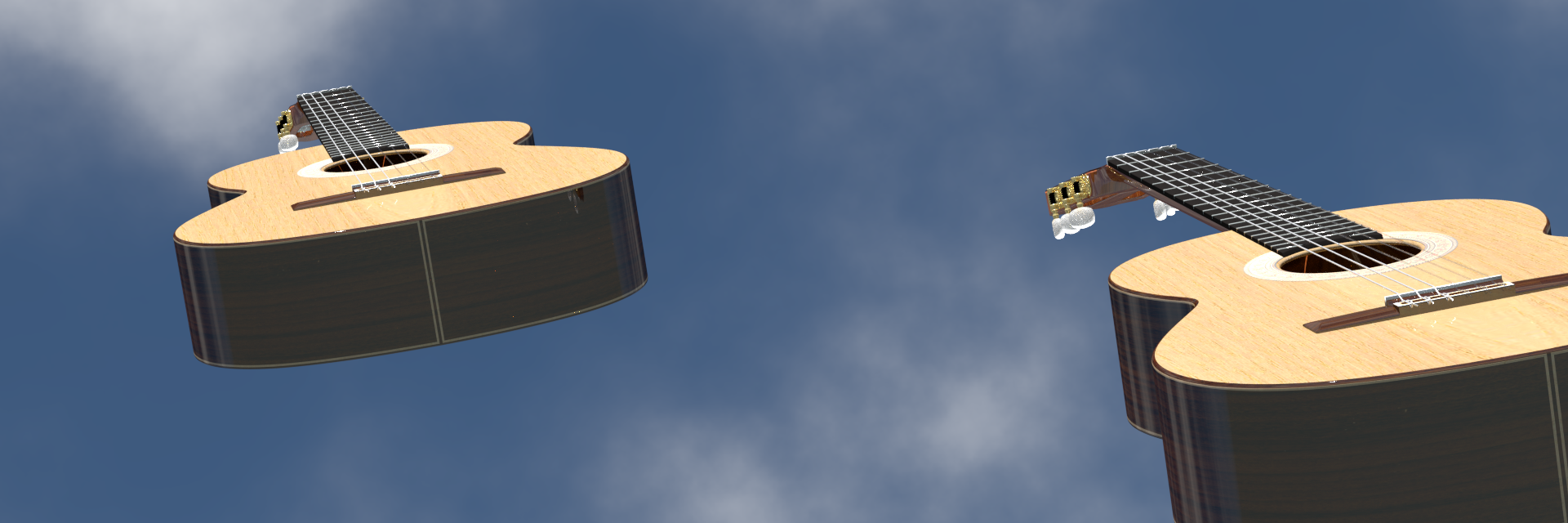Neues von der KI – Metronom programmieren
Dass ich mit den herkömmlichen Metronomen nicht so ganz glücklich bin, weil meine Wünsche eine Art Überforderung für diese darstellen, dürfte in diesem Blog nichts Neues sein. Jetzt bin ich im Rahmen des Unterrichts mal wieder auf das Thema Metronom gestoßen bzw. auf Dinge, die ich mit Musescore für meine Schüler gestaltet habe. Da stellte sich die Frage: Könnte das letztendlich nicht alles einfacher sein?
Schon lange überlege ich, ob es nicht schön wäre, ein Metronom zu haben, das eine latente Temposchwankung eingebaut hat, oder ein Metronom, das verschiedene Taktarten in Folge abspielt, versehen mit einer Tempokurve. Deswegen dachte ich mir einfach, ich frage mal eine KI, was sie für mich machen kann.
Diesmal warnte ich mich an Claude. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob es überhaupt möglich wäre, ein Metronom mit Claude zu programmieren. Die Antwort war ein funktionierendes Metronom, zwar simpel strukturiert, aber nicht schlecht. Irgendwie hat es sich dann ergeben, dass sich verschiedene Ideen in meinem Kopf kombinierten, ich Claude verschiedene Anweisungen gab und ich dann dieses Ergebnis hatte.
Das, was ich hier vorführe, ist noch nicht so richtig fertig. Aber ich finde, dass ich dafür, obwohl ich nur ein eineinhalb Stunden Zeit hineingesteckt habe, ein doch sehr beeindruckendes Ergebnis erzielt habe. Was soll dieses komische Konstrukt?
Persönlich finde ich es eine gute Methode, Rhythmusmodelle auf eine bestimmte Art und Weise zu üben. Nehmen wir einfach eine punktierte Viertel, Achtel und dann eine Viertel.
- Metronom läuft auf Achtel
- Metronom läuft auf Viertel
- Metronom läuft auf ganzen Takt
Dazu klatscht oder spielt man den Rhythmus.
Wenn man dies aber mit einem herkömmlichen Metronom macht, funktioniert diese Methode eigentlich nicht, weil man beim Umstellen zum Spielen absetzen muss und so weiter. Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Übeschritten, den man bräuchte, wird durch das Umschalten, Abbrechen des Klatschens zerstört. Also habe ich das bisher immer in Musescore gemacht, indem ich mir dementsprechende Schlagzeugspuren gebaut habe.
Jetzt habe ich solche Übungen für eine Schülerin gemacht und habe auch meine neue Idee verwendet: nicht die Signale plötzlich abzustellen, sondern sie kontinuierlich leiser werden zu lassen. Das habe ich versucht, in dem oben gezeigten Metronom unterzubringen.
Faszinierend fand ich eigentlich bei dem bisherigen Programmieren, dass ich keine einzige Zeile Code schreiben musste.
Einerseits glaube ich, man sollte diese Art des Programmierens ruhig probieren, auch wenn man keinen blassen Schimmer vom Programmieren hat. Andererseits kann es sein, dass diese Versuche sehr frustrierend sein können.
Teilweise weiß ich aus meinen bisherigen Programmiererfahrungen, wie ich meine Eingaben bei der KI mache. Andererseits kenne ich Lösungskonzepte beim Programmieren.
Was meine ich zum Beispiel? Ich habe Claude gefragt, ob es mit Soundfonts umgehen kann. Es hat mit Nein geantwortet. Wenn man aber natürlich weiß, dass es für solche Sachen Libraries gibt, die dann doch ermöglichen können, dass mit dem Soundfont umgegangen werden kann, dann kommt man auch auf die Idee, Claude zu fragen, ob es zum Beispiel solch eine Library verwenden kann.
Oder – das hat zwar jetzt etwas weniger mit Programmieren zu tun – hatte ich das Problem, dass das Ausblenden der einzelnen Signale nicht in der Form stattfand, wie ich es mir vorstellte. Da ich aber ein elektronisches Spielkind bin, konnte ich Claude diese Dinge in technischen Angaben vermitteln.
Also ich glaube, es ist notwendig, wenn man etwas programmieren will, dass man die technischen Konzepte dahinter kennt. Denn mit nur rein beschreibender Sprache stelle ich es mir schwer vor, dass man die Dinge bekommt, die man wirklich haben will.
Der Beitrag wurde am Freitag, den 3. Oktober 2025 um 20:33 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Eingeschoben, Gitarrenunterricht, Rhythmus, Software, Übematerial, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .