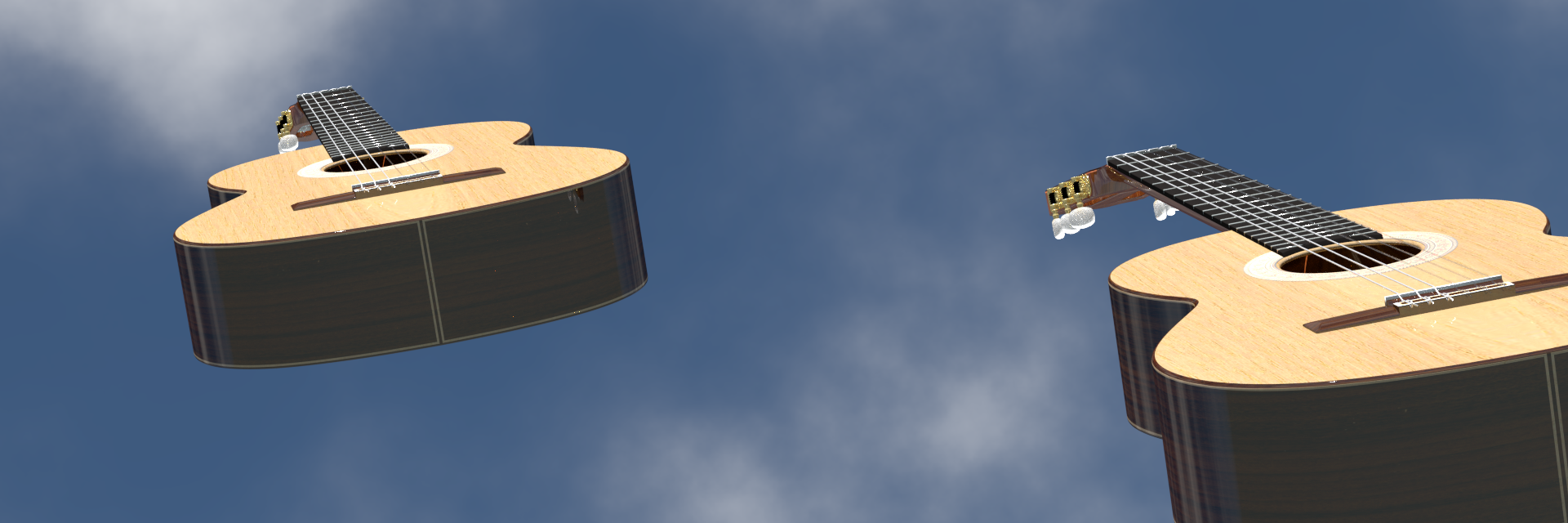Hängenbleiben
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, wurde mir in meiner Diplomarbeit durch die Bewegungslehre deutlich gemacht, dass beim Bewegungslernen eine Entwicklung stattfindet. Diese Entwicklung wurde in Parametern beschrieben, die hauptsächlich zum Inhalt hatten, wie sich die Bewegung dem Beobachter vermittelt. Bei den jetzt von mir gelesenen Lehrbüchern wird auch eine kognitive Entwicklung beschrieben.
Die Aufmerksamkeit geht von der Wahrnehmung der Bewegungssteuerung zur Wahrnehmung des Bewegungsziels. Die Übertragbarkeit auf das Instrumentalspiel stellt sich für mich eher als schwierig dar, denn was ist das Ziel?
Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Viele Schüler*innen nervt das Zählen, und sie fragen im besten Fall, ob das mal aufhört. Im schlechten Fall postulieren sie, ich würde ja auch nicht mehr zählen, sie wären schon weit genug und das müsste nicht mehr sein. Ich versuche ihnen zu vermitteln, dass ich schon noch irgendwie zähle, dass sich in mir ein Puls gebildet hat, an dem ich spüre, ob ich falsch spiele oder nicht.
Also hat eine Entwicklung bei mir stattgefunden, wie ich kognitiv rhythmische Fragen löse. Aber durch die sportwissenschaftlichen Arbeiten stelle ich mir die Frage, ob ich am Ende der möglichen Entwicklung bin oder ob ich vielleicht hängengeblieben bin. Denn wenn man den in der Musikpädagogik omnipräsenten Topos nimmt, letztendlich solle es nur von der Klangvorstellung abhängen, dann gibt es bei mir noch einiges zu entwickeln.
Aber so lange, wie ich Musik mache, und angesichts der Mengen an investierter Zeit, stellt sich die Frage: Wenn ich hängengeblieben bin, warum bin ich hängengeblieben? Aber es stellt sich auch die Frage, vielleicht bin ich am Ende der Entwicklung angekommen und sie weiterzutreiben, und nur noch über den Klang zu gehen, könnte zu unbemerkten Fehler führen. Ich hätte gerne einen doppelten Boden.
In den Erklärungsversuchen, die ich hier erläutern werde, beantworte ich eine Frage, die ich in diesem Blog des Öfteren stelle: „Warum erzeugt das Spielen eines Instrumentes so unterschiedlich starke musikalische Fähigkeiten?“ Der Kern meiner bisherigen Antworten war, eine Art kognitiver Overload behindere, dass sich musikalische Fähigkeiten entwickeln.
Aber es gibt auch andere Möglichkeiten.
Berge hinunterrasen
Ich fahre ziemlich viel Fahrrad in den umliegenden Mittelgebirgen und werde bei Abfahrten über Forststraßen immer wieder von Menschen überholt, die deutlich weniger als ich oder gar nicht bremsen.
Die Idee haben
Würde ich die anderen Personen nicht erleben, käme ich gar nicht auf die Idee, über mein Bremsverhalten nachzudenken. Ich komme sicher den Berg hinunter und habe keinen Stress. Warum sollte ich irgendetwas ändern? Warum sollte ich meine Strategie ändern?
Schüler*innen haben Methoden, die sie zu einem verlässlichen Ergebnis führen – warum dann einen „Change of a running system“?
Den Mut haben
Die Sturzgefahr und das Tempo, was jetzt am Berg trotz Bremsens entsteht, machen mich vorsichtig. Soll ich wirklich ein anderes Bremsverhalten riskieren? Ich bin derjenige, der seine Berufsunfähigkeit oder mehr riskiert. Die Sicherheit vor dem Fehler bewirkt auch, dass man an einer Strategie festhält, obwohl man vielleicht sogar einsieht, dass eine andere Strategie auf lange Sicht besser wäre. (Die Lehrperson motzt nämlich in der nächsten Stunde. Das Lob in ferner Zukunft, ist da doch eher unwichtig.)
Wie umsetzen?
Auch wenn ich mein Bremsverhalten ändern wollte, was bedeutet weniger, schwächer bremsen? Mit dem gerade genannten Punkt „Den Mut haben“ stellt sich die Frage: Was kann ich probieren und riskieren, wenn ich keine andere Strategie habe, sondern eine entwickeln will? Wenn ich keine Chancen bei den Änderungsversuchen auf Erfolg sehe, stelle ich die Versuche ein.
Wie vermittelt sich das Ziel?
Die Sportwissenschaften reden davon, das Entwicklungsziel wäre, sich auf das Ziel zu fokussieren. Die Beispiele beziehen sich aber auf solche Dinge wie den Korb treffen – Dinge, wo ziemlich einfach zu erkennen ist, ob man das Ziel erreicht hat.
Jetzt rede ich über den Unterricht, der mir gegeben wurde. Ich erinnere mich an meine erste punktierte Achtel mit folgender Sechzehntel. Mir wurde gesagt, ich würde diesen Rhythmus triolisch spielen. Mir wurde die zwei Varianten vorgespielt, in der Hoffnung, ich würde mir den Unterschied merken und dass dies reichen würde.
Dieser Eindruck verblasste bis zu Hause, und ich zählte einfach gnadenlos. Wenn ich das Zählen vergaß, hieß es wieder, ich würde triolisch spielen. Ich zählte und hatte mein korrektes Ergebnis. Zwar war mir klar, dass ich das hörend erkennen müsse. Aber es gab damals noch nicht die technischen Möglichkeiten wie heute, die mir erlaubt hätten, mir die nötigen Mengen an Beispielen anzuhören, um die nötigen Merkmale zu begreifen. Also blieb ich notgedrungen bei der Strategie Zählen.
Oder mir wurde auch gesagt, Ton xyz sei in dem Akkord zu schwach. Erst durch das Fach Gehörbildung war ich wesentlich besser in der Lage, dies zu beurteilen, denn dadurch war ich wesentlich besser in der Lage, auf einzelne Töne in einem Zusammenklang zu fokussieren. Eigentlich empfand ich einen Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich kenne das Phänomen aus meinem Unterricht. Viele Schülerinnen hören nicht, wenn sie einen Basston zu früh loslassen. Aus der Anweisung „Der Ton muss bis zum nächsten Ton klingen“ wird rasend schnell „Der Finger muss liegen bleiben“ gemacht. Ich sage zwar den Schülerinnen, dass es besser wäre, wenn sie es hören würden, und mache einige Übungen mit ihnen bzw. empfehle ihnen welche. Die Übungen im Unterricht sind zu wenig, die zu Hause zu umständlich.
Also achten die Schülerinnen darauf, dass der Finger liegen bleibt. Vielleicht könnten sie nach einer Weile sogar hören, ob der Ton weiter klingt. Bloß die Kontrollmethode über den Finger ist mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Da denkt man nicht mehr daran, dass man das auch mal mit Hören machen könnte. Im schlechteren Falle läuft es so: Wenn Schülerinnen versuchen sollten, es zu hören, haben sie so viele Versuche, bei denen sie keinen Erfolg haben, sodass sie es vermutlich lassen und den einfachen und sicheren Weg gehen.
Also, dass sich Musikalität trotz Instrumentalspiel schlecht entwickelt, ist teilweise ein psychologisches Phänomen. Die Sache läuft, man hat Freude an der Sache – warum daran rühren, wenn man überhaupt auf die Idee kommt, an der Sache zu rühren? Wenn die Lehrkraft auf die Idee kommt zu rühren, ist die Frage, wie viel Erfolgsaussicht die Schüler*innen erleben, sodass sie freudig mitrühren.
Der Beitrag wurde am Freitag, den 16. Mai 2025 um 08:34 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Forschung, Gitarre lernen, Gitarrenunterricht, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .