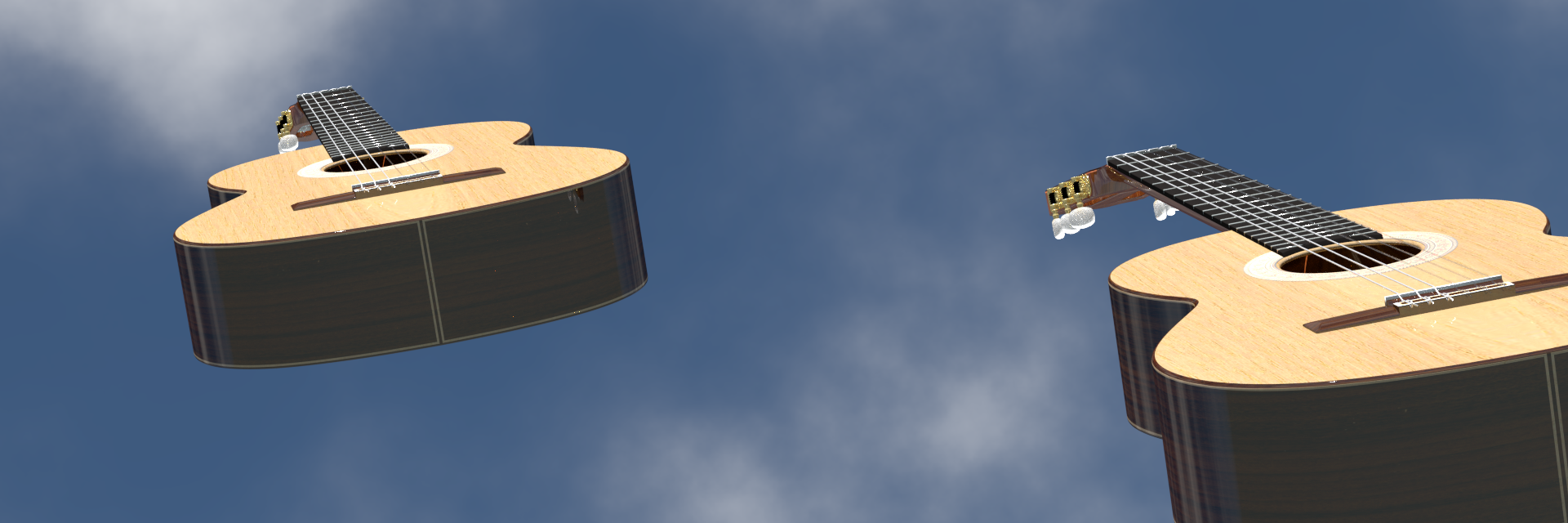Das Prinzip Hoffnung oder sogar Zufall
Als ich mich jetzt wieder mit Gehörbildung beschäftigt habe, bin ich natürlich wieder über Solfege und das Zahlensingen von Rousseau gestolpert. Von Solfege ging während meines Studiums ein mysteriöser Hauch aus. Die Franzosen wären so toll in Gehörbildung, weil sie Solfege machen würden. Aber wir in Deutschland würden das nicht können.
Die Grundidee von Solfege dürfte eine Art Synästhesiebildung oder Konditionierung sein. Meinen Quellen nach, soll man die Silben mithören und die Gesten mitempfinden, wenn man Musik hört. Bzw. die Gesten unterstützen die Tonvorstellung.
Aus Neugierde wie Solfege praktisch aussieht, habe ich mir ein paar Videos angesehen und stieß auf Tutorials, die ich mitmachte. Irgendwann dachte ich mir, eigentlich wäre es doch besser für die Synästhesiebildung, wenn ich nicht einfach stumpf die Gesten und Silben mitsinge, sondern die Stufe des Tones mit meinen in der Gehörbildung gelernten Techniken feststelle und dann deswegen die Geste mache und die Silbe singe.
Jetzt gibt es in meinem Unterrichtsgebiet ein Gymnasium mit einem musikalischen Schwerpunkt. Und dort wird in den Chören Solfege betrieben.
Wenn ich mal wieder nach Gehör spielen lasse, frage ich ab und zu, was würde der Ton für eine Silbe oder Geste bekommen. Die Schüler*innen können das nicht beantworten. Sie reagieren auf die Frage mit Unverständnis. Aber sie können die Passage nachspielen. Und sie haben meiner Meinung nach ein mehr oder weniger ausgeprägtes Gefühl dafür, wo die Töne liegen könnten. Ebenfalls deutlich ausgeprägter als im Solfegesystem.
Meine Erklärung dafür, die Kinder müssen die Töne beim Nachspielen aktiv identifizieren und umsetzen. Bei Solfege nicht.
Ich will die Solfege jetzt damit nicht schlecht reden. Aber bei meinen weiteren Überlegungen fiel mir auf, es gibt Instrumente auf denen sind die Tonabstände begreifbarer als auf anderen Instrumenten. (Wir Gitarristen haben da ganz schlechte Karten.)
Trotzdem wäre mir in meinen Gehörbildungskursen nicht aufgefallen, dass sich bestimmte Instrumente beim Melodiediktat oder Aufgaben wie Intervallen sukzessive vorgespielt wesentlich leichter getan hätten.
Die Frage schoss mir in den Kopf, warum soll eigentlich bei der Solfege so viel verlässlicher eine Synästhesie entstehen als, wenn man ein Instrument spielt. So unähnlich ist das alles doch nicht.
Und bildet sich diese Synästhesie so verlässlich wie behauptet?
Weil ich etwas zur Gestenausführung wissen wollte, fragte ich einen meiner Schüler. Lapidarer Kommentar: „Weiß ich nicht, ich habe immer gemacht, was die anderen gemacht haben.“
Der Schüler spielt eigentlich nicht besser nach Gehör als seine ein Jahr jüngere Schwester, die erst eine Solfegeerfahrung von einem viertel Jahr hat. (Als ich sie bat, do – re zu singen, hatte das re dieselbe Tonhöhe wie das do. Auf meine Frage, ob das re nicht höher sein müsste als das do, erzeugte Unverständnis.)
Aus den Gesprächen mit meinen SchülerInnen weiß ich, dass ihnen gar nicht klar ist, was das mit der Solfege soll. Sie machen es halt. Sie nehmen es in Kauf, weil sie den musikalischen Schwerpunkt gewählt haben. Ein lästiges Übel.
Das hat mich auf den Gedanken gebracht, vielleicht liegt es nicht an der Methode, sondern warum man sich mit einer Methode auseinandersetzt.
In der Gehörbildung stachen Leute hervor, die spaßeshalber solche Dinge aus Neugierde trainiert hatten.
Zum Beispiel eine Kommilitonin tat sich extrem leicht, weil sie sich in ihrer Jugend den Spaß gemacht hat, zu versuchen alles, was sie gehört hat, auf der Gitarre vorzustellen. Also eine aktive Auseinandersetzung.
Oder Student*Innen, die ein extremes musikalisches Training abbekommen hatten.
Z.B. ein ehemaliger Regensburger Domspatz. Da mein Kindheitsnachbar dort auch war, weiß ich, was die für ein Programm hatten. Bzw. die Domspatzenverbannten und -flüchtlinge in meinem Internat wussten auch so einiges zu erzählen. Wer bei den Domspatzen war und blieb, wollte das. (Es wurde von Ohrfeigen und fliegenden Gegenständen bei falschen Tönen berichtet. [Bevor die Domspatzen als besonders roh dastehen, Ohrfeigen war auch in unserm Internat üblich. Es war die Zeit als die Gewalt aus der Erziehung verschwand, aber die Internate in Regensburg, in die ich Einblick hatte, waren schon ein Schlusslicht in dieser Frage.])
Es gab die kuriose Situation, dass wir Studenten aus der Hochschulvorbereitungsklasse des Frankfurter Konservatoriums, obwohl wir eigentlich die ersten Semester dasselbe machen mussten, wie in der Hochschulvorbereitungsklasse von diesen Leuten in die Tasche gesteckt wurden und auch sonst stießen wir nicht sonderlich positiv hervor. Eines hatten wir aber gemeinsam, Gehörbildung war für uns eine Pflichtübung.
Und eine Sache fiel auch auf, Student*Innen aus romanischen Ländern, die Solfege als Pflichtprogramm in ihrer musikalischen Ausbildung hatten, meinten einerseits, obwohl sie Solfege gehasst hätten, würde es ihnen jetzt in der Gehörbildung helfen. Aber sie schwammen im Mittelfeld mit. Akkorde und Harmoniediktate fielen ihn teilweise schwer.
Also nicht das, was man bei dem Nimbus der Solfege erwarten würde.
Aber jetzt weg von der Solfege.
Die Frage lautet: „Bildet man Zusammenhänge, wenn man sie bilden kann?“
Eigentlich hätten wir klassischen Gitarristen in der Gehörbildung auffallen müssen, indem wir einfache Harmoniefolgen gut erkannt hätten.
Wieso? Da wir Akkorde als Griffbild kannten, konnten wir sogar ohne musiktheoretische Kenntnisse erkennen, in was für einer Harmonie wir spielen. Und wir haben Akkorde gespielt. Eigentlich fast so stumpf, wie sie uns in der Gehörbildung angeboten worden sind. Ich glaube, wir waren das Instrument, dass in dieser Frage im musikalischen Vorleben das geeignetste Material gespielt haben, um Zusammenhänge zu erkennen und zu bilden. Geholfen hat uns das erstaunlich wenig.
Bloß warum? Dazu zwei Geschichten aus meinem Unterricht.
Wenn Schüler*Innen Akkorde spielen können, frage ich sie ab und zu, was sie gerade für eine Harmonie spielen würden. Ich muss alle beim ersten Mal mit der Nase darauf stoßen, dass das Griffbild des Stückes Ähnlichkeiten mit einem Akkordgriff hat. Aber es wird spannend, wenn ich später mal wieder frage. Manche wissen sofort, was ich will, und können antworten. Anderen muss ich erst wieder an diese Möglichkeit erinnern.
Oder anderes Setting. Ab und zu spiele ich zweistimmig vor, und lasse die Unterstimme nachspielen. Die Kinder suchen sich die Oberstimmentöne heraus und kombinieren Basstöne dazu. Manche wollen mir zeigen, dass sie mich austricksen und erzählen mir ganz stolz, sie würden die Töne ausprobieren, die normalerweise mit dem Ton in der Oberstimme gespielt werden.
Den Schüler*Innen, die planlos herumprobieren, gebe ich den Tipp, überlege doch, womit der obere Ton gerne kombiniert wird. Das hilft aber nicht unbedingt, denn einigen ist gar nicht aufgefallen, dass es immer wiederkehrende Tonkombinationen gibt.
Also was anderen im Nebenbei auffällt, muss anderen mühselig beigebracht werden.
Dann ist auch immer noch die Frage, sind die Zusammenhänge überhaupt so gut wahrnehmbar, wie wir Musiker mit unserem Training so meinen.
Es fängt schon mit der Frage an, wann ist ein Ton gleich. Spiele ich das g leer oder auf der d-Saite gegriffen, erklären mit teilweise auch erwachsene Anfänger, dass dies doch wohl unterschiedliche Töne seien.
Oder ich singe eine Tonhöhe mit verschiedenen Vokalen. Damit kann man auch viele Leute mit einiger musikalischen Erfahrung verwirren.
Aber dieses Problem geht auch noch weiter. Ich habe einer Schülerin statt die Töne auf der Gitarre vorgespielt, vorgesungen. Sie findet die Töne, wenn ich auf der Gitarre spiele, sofort. Als ich sang, war sie absolut hilflos. Als ich aber den Ton sang, den sie spielte und sagte, die Töne wären gleich, protestierte sie vehement.
Einem anderen Schüler spielte ich eine kleine Dezime auf der Gitarre vor. Die hatte er sofort herausgefunden. Dann spielte ich ihm dieselbe Dezime mit einem Notensatzprogramm mit einem Harmoniumklag vor. Er erkannte die Dezime nicht wieder. Aber er fand nicht einmal die Töne erneut heraus. Interessanterweise er war sich todsicher, dass der Ton, der die kleine Dezime zu einem Durdreiklang machen würde, wäre richtig. Also schaltete ich auf einen Klavierklang um. Er versteifte sich trotzdem auf diesen einen Ton.
Es stellt sich die Frage, geht der Schüler über Tonhöhen oder andere Merkmale, wenn er Gitarrenklänge vergleicht.
Bloß wenn er über andere Ähnlichkeiten hört, dann bildet er „falsche“ Zusammenhänge heraus.
Interessanterweise schaffte ein anderer Schüler diese Aufgabe. Weiter hinten im Stoff, weniger engagiert, aber älter. Wo liegt der entscheidende Unterschied. Der Schüler, der es nicht geschafft hat, spielt wesentlich besser nach Gehör nach.
Ich staunte nicht schlecht, als ich mit einer Schülerin ungefähr mit einem knappen Jahr Abstand zu dem Lied „Atte Katte Nuwa“ das Lied Gubben Noak arbeitete. Sie erklärte mir, dies wäre Atte Katte Nuwa, aber der Rhythmus sei anders. Es fiel mir auch erst in dem Moment auf, als sie es sagte. Seitdem teste ich mal wieder die Schüler*Innen und spiele beide Stücke vor. Nur ganz wenige bemerken die gleiche Struktur.

Sind diese Strukturen wirklich so offenhörbar, wie wir Musiker meinen?
Z.B. hat man uns im Gehörbildungsunterricht beigebracht, dass jeder Ton eine Funktion hat, an der man ihn erkennen kann. Das hat auch alles wunderbar funktioniert, solange einstimmig vorgespielt wurde. Aber wurde der Kontext mehrstimmig, konnte man die Funktion zwar immer noch wahrnehmen. Aber wenn ein g in C-Dur mit G-Dur erklingt. Dann hat das g bezgl. des G-Durs einen Grundtoncharakter, aber bzgl C.Dur Quintcharakter.
Und so laufen bei richtiger Musik vielfach Informationen mit, welche die angeblich so klare Sache verschleiern. Daraus erklärt sich dann meiner Meinung nach auch, warum dass in der Gehörbildung gelernte, dann teilweise in der freien Wildbahn nicht oder schlecht funktioniert.
Wie soll also der untrainierte Laie unter diesen Umständen Strukturen im Nebenbei unterbewusst erkennen, die man den Musikstudenten mehr oder weniger mühselig beibringt.
Jetzt wieder zurück zur Solfege. Ich habe mir verschiedene Einleitungen angesehen. Die Einstiegslevel waren stark unterschiedlich. Ab und zu frage ich meine Schüler*Innen: „Merkst Du, ….?“ Es gibt dann auch die Reaktion: „Ich habe genügend andere Probleme, darauf achte ich nicht.“ So hatte ich auch bei mancher Einführung das Gefühl, dass könnte ein Overload sein. Bloß wie soll man dann wieder unterbewusst im nebenbei Muster erkennen und Verbindungen bilden.
Die Solfege muss noch einmal herhalten. Bei der Bewertung der Solfege dürfte ein gewaltiger Bias herrschen. Alle diejenigen, bei denen Solfege nicht funktioniert hat, kommen nicht in die Positionen, wo über diese Fragen, ob Solfege sinnvoll ist oder nicht, diskutiert wird.
Würde man in Deutschland die Gehörbildung in den Musikschulen genauso verpflichtend machen, wie die Solfege in Frankreich, würden viele über die deutsche Gehörbildung schwärmen.
Wie gesagt, mir geht es nicht darum, die Solfege schlecht zu machen, sondern ich habe versucht herauszufinden, wie sich musikalische Vorstellung bildet und wie man sie trainieren kann. Wissenschaftlich gesehen gibt es wenig dazu und nichts, was in meinen Augen weiterhelfen würde.
Und an der Solfege zeigt sich, dass all diese Methoden eine Art Bias haben. Hat mir geholfen, bin erfolgreicher Musiker, also muss das allen helfen. Das Glück des Begabten ist aber, dass ihm auch sogar schlechte Methoden helfen, aber der Unbegabte scheitert.
Und deswegen die Frage, kann es sein, dass all diese Methoden eher zufällig funktionieren und man nur hofft, dass die Dinge funktionieren? Und das alles nicht sonderlich zielgerichtet ist.
Denn mir ist aufgefallen, wie viel Übeaufwand in den deutschen Gehörbildungsbüchern gefordert wird. Da sind Studennt*Innen die zur Aufnahmeprüfung 4000 bis 6000 Stunden ihr Instrument geübt haben, dann im Studium pro Tag 4 bis 6 Stunden üben. Und die haben dabei so wenig musikalisches Gehör entwickelt, sodass sie jeden Tag eine halbe Stunde Gehörbildung üben sollen. Am besten lebenslang.
Könnte es sein, dass da irgendetwas sehr undurchdacht ist?
Der Beitrag wurde am Freitag, den 27. Januar 2023 um 08:54 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Gehör, Musikalität, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .