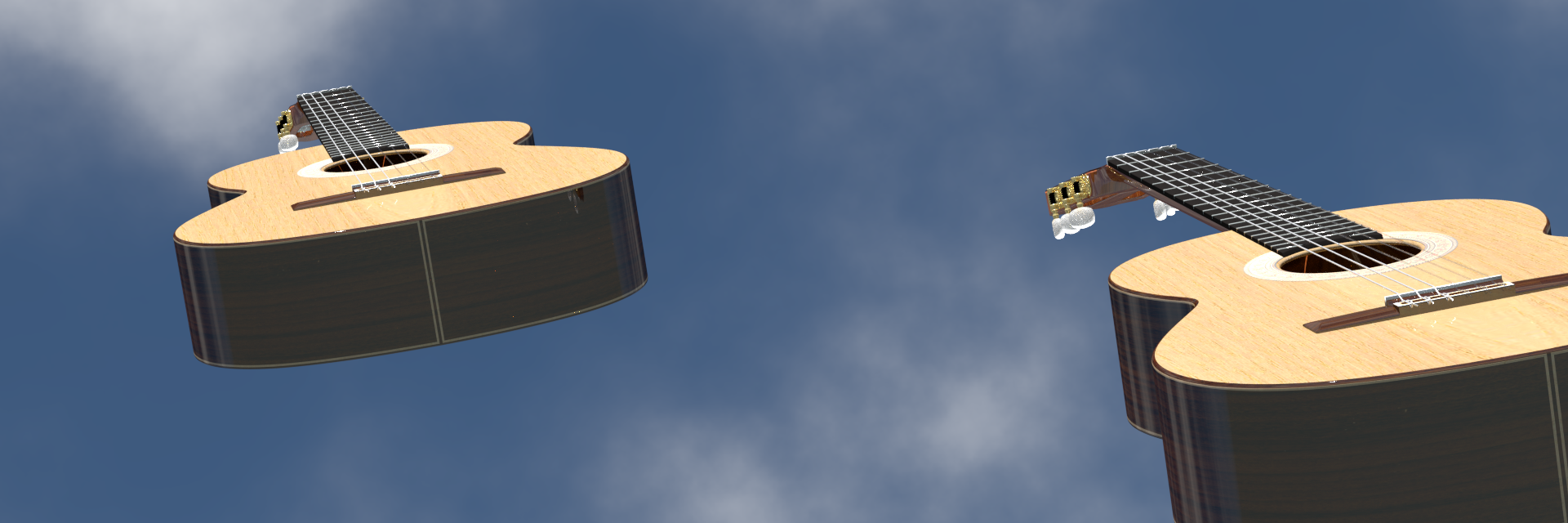Movment Reinvestment – Implicit motor learning
Mein Artikel Optimal üben – Buchbesprechung mag vielleicht so wirken, als würde ich von dieser Idee des impliziten motorischen Lernens nichts halten. In gewisserweise stimmt das, denn es wirkt so auf mich, als würde es in diesem Buch als Allheilmittel betrachtet. Andererseits als ich versucht habe zu erstehen, worum es geht, fand ich die Auseinandersetzung damit sehr produktiv, denn es lassen sich vielleicht Phänomene erklären, von denen ich nur aus Erfahrung weiss, dass es sie gibt.
Aber ich habe aufgehört, mich mit diesen Thema zu beschäftigen, weil die von mir gelesenen Texte mehr Fragen öffnen als beantworten. In den Arbeiten werden Wirkmechanismen für die Erklärung der Ergebnisse von Versuchen formuliert, wo ich mir spontan aus meiner Übeerfahrung dachte, habt ihr auch überprüft, ob es nicht daran liegen könnte?
Als ich nach Übersichtarbeiten zu diesem Thema suchte und nicht sehr viele fand, aber wenn, dann die Methodik dieser Forschungen kritisiert wurde und das alles anscheinend nicht so gesichert genannt wurde, stieg in mir die Befürchtung auf, weil ich auch zum Experimentieren anfing, dass ich in die Irre gehen könnte und meine Zeit vergeude. Aber diese Theorie bauen darauf, dass eine nicht bewusst kontrollierte Bewegung besser funktioniert als eine bewusst kontrollierte. Aber ob dieses Axiom wirklich als erwiesen gilt, kann ich nicht herausfinden.
Jemand Berufener müsste sich um das Thema kümmern.
Als ich mich mit dem impliziten motorischen Lernen beschäftigte, stieß ich schnell auf den Begriff des „movement reinvestment“. Kurz gesagt, es geht um ein Problem, was jeder kennt, der ein Instrument spielt, falls man anfängt, darüber nachzudenken, was man macht, dann bricht das Spiel zusammen.
Etwas weniger salopp ausgedrückt, in Stresssituationen setzt eine bewusste Kontrolle von automatisierten Bewegungen ein, was die automatisierten Bewegungen (zer)stört. Dies soll umso leichter geschehen,
- je mehr der Ausführende deklaratives Wissen
- oder aufgabenrelevantes Wissen besitzt,
- je selbstfokussierter der Ausführende bei der Aufgabe oder als Person ist.
Durch eine Aufmerksamkeitslenkung auf externe Reize kann man das Arbeitsgedächnis so belasten, sodass es nicht mehr bewusst kontrollieren kann, sodass es nicht interveniert.
Die andere Strategie ist, die Menschen lernen die Bewegung so, sodass sie kein deklaratives bzw. aufgabenrelevantes Wissen sammeln können. Das wäre das implizite motorische Lernen.
Eigentlich fand ich die Texte, um den Begriff des „movement reinverstment“ wesentlich interessanter. Zuerst die Theorie um das „movement reinverstment“ schlägt als Lösungsstratgie eine bestimmte Art der Aufmerksamkeitslenkung vor. Meine Befürchtung, was vielleicht so mancher kennt, wenn dann diese Strategie beim Vorspiel nicht funktioniert, dann interveniert der Kopf, die daraus resultierende Angst auch wieder und die Bewegung bricht zusammen. Also man verschiebt das Problem auf eine andere Ebene.
Ich kann mich an einen Antiangstkurs an meiner Hochschule erinnern. Bei einem Flurgespräch stellten die Beteiligten nach einiger Zeit fest, dass sie noch mehr Angst hätten, weil sie jetzt wüssten, was sie tun müssten, aber wenn das nicht so richtig klappt, dann geht die Angst so richtig los.
Der Tesafilm
In meiner Hochschulzeit erzählte mir eine Sängerin ganz begeistert von einem Trick aus ihrem Funktionalen Stimmtraining. Sich einen Tesafilm auf das Kinn zu kleben und beim Singen zu versuchen, diesen zu spüren. Das Singen würde besser funktionieren, sie würde nicht so verkrampfen.
Ich probierte ähnliche Dinge und stellte ähnliche Effekte fest. Zum Beispiel beobachtete ich, wie sich mein musikalisches Mitbewegen sich in den Fußsohlen anfühlt. Dadurch wurde mein Spielen flüssiger.
Dies passt mit der Theorie des „movement reinverstment“ zusammen. Einsetzende bewusste Kontrolle schwächt den Bewegungsfluss. Dem könne man entgegenwirken, indem man sich auf externe Reize konzentriert.
Jetzt komme ich ein wenig zu einem praktischen Problem dieser Theorie. Einerseits versucht man zu beschreiben, auf was für eine Art von Reizen man sich konzentrieren sollte. Aber dies geschieht in einer Art und Weise, dass ich dann doch nicht so recht weiß, ist ein bestimmter Reiz nach dieser Theorie sinnvoll oder nicht.
Zum Beispiel, wenn ich auf das Griffbrett schaue und meine Finger beobachte, dann sammle ich einerseits aufgabenrelevantes Wissen, aber achte ich auf einen externen Reiz. Diese Frage stellt sich noch viel stärker, wenn ich auf das Gefühl meiner Finger fokussiere, wie sie den Bund oder das griffbrett berühren. Ist das eine schädliche Selbstfokussierung oder ein externer Fokus?
Mancher wird sagen, dass ist selbstverständlich kein externer Fokus. Aber in einem Experiment kommt heraus, dass Parkinsonkranke weniger stürzen, weil sie das Papier unter ihren Füßen spüren sollen. Was ist dann das Spüren des Griffbrettes unter den Fingern, der Kontakt der Finger mit den Saiten?
Oder was ist in diesem System das Sich-Zuhören.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Herumexperimentieren, worauf man achtet, vielleicht zu einem Erkenntnisgewinn für einen selbst wird.
Kontrolle oder Beobachtung
Die von mir gelesenen Texte verwenden den Begriff der Kontrolle. Kontrolle ist ein Prozess, bei dem, falls nötig, eingegriffen wird. Beobachtung greift nicht ein, wertet vielleicht sogar nicht.
Vielleicht lässt sich das Problem des Eingreifens damit bewältigen, indem man lernt, nur zu beobachten und die Dinge geschehen zu lassen. (Ja, meine Esoterikklingel ging beim Schreiben auch an.)
Vertrauen in die Bewegung
Bei dem schon weiter oben erwähnten Experiment mit den Parkinsonkranken wird berichtet, dass Parkinsonpatienten, welche häufig stürzen eine höhere bewusste Bewegungskontrolle haben als Patienten, die wenig stürzen. Sie kontrollieren mehr, weil sie kein Vertrauen in ihre Bewegungen haben. Bloß das Beeinträchtigt ihre Steuerung und sie stürzen deswegen mehr. Also versucht man durch Dual-Task-Aufgaben die Bewegungskontrolle abzubauen.
Dual-Task-Aufgaben bestehen aus der simultanen Ausführung einer aktiven Bewegung (Motorik) und einer geistigen Aufgabe (Kognition).
Leider wurde nicht genauer erklärt, warum die Kontrolle abnimmt. Mein Erklärungsversuch, man gewinnt wieder Vertrauen in seine Bewegungen.
Die Sache mit den Stützrädern
Stützräder gelten als ungeeignet, das Fahrradfahren zu lernen, weil man nicht lernt, wie man das Gleichgewicht in den Kurven hält. In Kuren setzen die Stützräder auf. Es ist nicht notwendig das Gleichgewicht zu halten.
Montiert man die Stützräder ab und das Kind stürzt sehr schmerzhaft in der ersten Kurve, wird es nach den Stützrädern verlangen.
Rein theoretisch wäre es möglich, dass die Stützräder im Laufe der Zeit immer wieder um einen Zentimeter höher vom Boden weg montiert werden. Also der Bereich, indem man Gleichgewicht halten muss steigt allmählich. Das Kind lernt schrittweise, ohne Sicherungsmechanismen zu fahren.
Die Frage ist, ob wir Musiker wirklich Strategien haben, unseren Bewegungen zu trauen. Es gibt zwar Vorspieltrainings, die sozusagen von der ganz kleinen Bühne zur großen Bühne gehen. Aber wie sind die Schritte zur kleinen Bühne oder sogar zum Vorspiel im Unterricht? Kann man da vielmehr kleine Schritte machen, als gemacht werden.
Beispiel. Ich habe versucht bei jedem Takt rückwärts zu zählen. Einmal fing ich bei 10 an, dann mit 100, dann mit 1000. Ab 10 geht leichter als von 100. Bei 1000 kann ich die Zahlen nicht aussprechen. Ich sage die Ziffern in der Reihenfolge. Also zum Beispiel „Neun, neun, sieben“ statt Neunhundertsiebenundneunzig.
Ich frage mich, wenn ich dies könnte, ob dies ein Hinweis darauf ist, dass die Bewegung besser gelernt ist.
Es mag zwar sein, dass die kleine Bühne funktioniert. Aber diese funktioniert vielleicht deswegen, weil ich die Kontrolle behalte und damit nicht sehe, dass ich keine Kontrolle brauche. Aber das wirklich Erleben, dass die Kontrolle nicht nötig ist, gibt mir das Selbstvertrauen nicht eingreifen zu wollen. Die Frage lautet, gibt es genügend verrückte Versuche für das stille Kämmerlein, um das für sich herauszufinden.
Mancher kennt noch die Empfehlung, schaue ein spannendes Fußballspiel, wenn du dein Stück dann immer noch kannst, dann kannst Du es wirklich. Bloß mehr Zwischenstufen, bevor man seiner Lieblingsmannschaft beim knappen Verlieren zusieht, wären in der Sichtweise des „movement reinvestment“ vermutlich eine sinnvolle Sache.
Zum Rückwärtszählen noch ein kleiner Nachtrag. Mittlerweile habe ich gelernt, solche Aufgaben nennen sich Dual-Task-Aufgaben. Einerseits verwendet man diese Aufgaben, um die Automatisierung einer Bewegung zu testen, andererseits um die Automatisierung zu fördern.
Ziemlich frappierend ist, wie leicht ich noch von 1000 rückwärts zählen kann, wenn ich Rad fahre oder gehe. Erst ab 10.000 rückwärts bemerke ich eine leichte geistige Anspannung. Vielleicht kann man mit Dual-Task-Aufgaben mit alltäglichen Tätigkeiten sich einen Maßstab entwickeln, wie gut ein Stück funktioniert. Also z.B. wenn von 100 rückwärts Zählen genauso locker von der Hand geht, wie beim Gehen rückwärts von 10.000 zu zählen, dann ist die Bewegung gut genug automatisiert.
Relying on the trick
Es gibt aber ein Problem bei dieser Sache. Was ist Stützrad und was ist Gleichgewicht? Simples Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen einen Lauf gespielt, ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und stellte fest, wenn der Lauf gut phrasiert ist, bewegt sich mein Oberkörper auf eine bestimmte Art und Weise mit. Blockiere ich den Oberkörper, dann ist die Phrasierung perdu. Also achte ich darauf, dass der Oberkörper frei mitagieren kann und denke zum Klang die Bewegung mit.
Und so gibt es viele Dinge, von denen ich weiß, wenn es so klingt, dann passiert auch dieses oder jenes in meinem Körper, so sehen dann die Finger aus usw. Diese Dinge verschmelzen zu einer Einheit mit dem Klang.
Betrachtet man das mit den Augen der Theorie des „movement reinvestment“ sind das schädliche Stützräder, weil explizites Aufgabenwissen. Für mich aber eine Art Sicherheitsanker.
Wie stürze ich mich selbst über diese Klippe?
Andererseits könnte man mit der Theorie des „movement reinvestment“ sagen, dass sind Reize, auf die man sich konzentrieren kann, damit man nicht eingreift.
Falls manche*r jetzt „Hä“ sagt, dieses „Hä“ hatte ich auch des Öfteren beim Lesen der Texte. Die Terminologie war etwas schwammig. Z.B. was ist ein externer Reiz? Das Gefühl, in was für einer Lage mein Finger ist, ist eindeutig ein interner Reiz. Aber das Gefühl vermittelt durch einen Handschuh, der auch diese Lage vermittelt, was ist das? Extern oder intern?
Oder der Begriff deklaratives Wissen. Die verlinkte Seite liest sich so, dass Sinneseindrücke kein deklaratives Wissen sind, weil schwer verbalisierbar. Aber wenn ich meine Oberkörperbewegung bei meiner Phrasierung beschreiben kann?
Also ich kann nicht herausfinden, ob mein „Relying on the Trick“ nützlich oder schädlich ist.
Fehlerreduziertes Üben
In einem der Artikel wird ein Experiment mit dem Putten des Golfspiels beschrieben. Der Abstand zum Loch wurde in 25 cm-Schritten erhöht. Die Idee dahinter, die Leute machen so wenig Fehler und haben so wenige Misserfolge, sodass sie nicht zur bewussten Bewegungskontrolle greifen. Diese Leute waren besser und sicherer beim Putten als andere Probanden bei denen die Abstände um 25 cm verringert wurden bzw. diejenigen die immer über den Maximalabstand putten mussten.
Mancher wird sagen, dies ist das alte gute pädagogische System der kleinen Schritte. Aber für mein Empfinden machen die 25 Zentimeter klar, dass die kleinen Schritte, die das pädagogische System der kleinen Schritte einem eingibt, vielleicht doch ziemlich groß sein können.
Das Selbstgespräch
Der Theorie des „movement reinvestment“ kritisiert, dass die Sportler durch Erklärungen sich selbst bei der Bewegungsausführung verbale Kommandos geben und ihre Bewegungen verbal mit den Vorgaben abgleichen. Analogien wären besser.
Was immer man davon halten will, die Erläuterungen zu diesem Thema haben mir wieder bewusst gemacht, dass man sich darum kümmern muss, was der Lernende aus einer Bewegungsanweisung macht.
Aus meinen Gesprächen mit meinen Schülerinnen weiß ich, in manchen evoziert eine Anweisung ein Bewegungsgefühl, die anderen haben ein Film vor ihrem geistigen Auge, andere agieren mit dem gesagten Text in sich weiter.
Die letzte Gruppe findet es hilfreich, den Text in eine visuelle oder kinästhetische Vorstellung umzuwandeln. (Dies schreibend fällt mir auf, dass ich noch nie jemanden, der automatisch ein Bewegungsgefühl konstruiert gebeten habe, mit Text zu arbeiten.)
Lassen wir es jetzt dahingestellt, was sinnvoller ist, aber vielleicht sollte man darauf achten, was die Lernenden aus einer Bewegungsinformation in ihrem Kopf machen.
Wenn ich in diese Richtung interveniere, stelle ich fest, dass die Leute nicht sofort so in ihrem Kopf arbeiten, wie ich es fordere. Sie brauchen Zeit die Informationen in den von mir gewünschten Modus umzusetzen.
Dies schreibend frage ich mich, wie viel Zeit geben wir Lehrkräfte den SchülerInnen solche Informationen wirklich umzusetzen. Aber auch wie viel Zeit geben sich SchülerInnen oder Übende zu Hause, zwischen Bewegungsinformation und ihrer Übersetzung im Kopf.
Analogien
Wie schon geschrieben, Analogien wären nach der Theorie „movement reinvestment“ besser als verbale Anweisungen, über Gliederstellungen, Gelenkwinkel, usw, weil dann eine erhöhte Abgleichgefahr besteht und man dann eingreift.
Diese Aussage hat mich verwundert. Eine Analogie setze ich auch in ein Bewegungbild oder Gefühl um. Ich teste, ob meine Bewegung etwas mit der Analogie gemeinsam hat.
Gehen wir davon aus, dieser Abgleich würde nicht stattfinden, dann habe ich ein anderes Problem. Um die Bewegung zu evozieren, muss ich die Analogie bewusst aufrufen. Damit habe ich das Problem des Abgleiches auf einer anderen Ebene. Ich gleiche ab, ob ich mir die Analogie gut genug vorstelle, ob genauso, als die Bewegung sehr gelobt wurde, usw. Es besteht meiner Meinung nach die Gefahr – Achtung Neologismus – „consciouness reinvestment“.
Implicit motor learning
Nachdem ich ein wenig über implicit motor learning gelesen habe, scheint es mir, dass die Grundidee des implicit motor learning ist, dass man möglichst wenig Wissen über die Bewegung sammeln kann. Man geht sogar so weit, dass man versucht, die Wahrnehmung des Ergebnisses der Bewegung (getroffen oder nicht) zu erschweren. Persönlich frage ich mich, wie man unterbewusst einen Fingersatz lernen soll?
Auch andere Dinge machen mich bei dieser Theorie stutzig. Praktische Erfahrungen aus meinem „sportlichen Alltag“.
Ich fahre seit einige Zeit mit meinem Handy, welches mir Herz- und Trittfrequenz anzeigt, am Lenker. Sinn der Übung, dass meine Herz- und Trittfrequenz sich von selbst in einem höheren Bereich bewegt. Sehr viel Erfolg habe ich damit nicht. Das erklärte ich mir damit, dass ich zu wenig auf den Bildschirm schaue.
Aber im Sinne des „implicit motor learning“ wäre das genau richtig, weil der Bildschirm sich eigentlich permanent in meinem peripheren Gesichtsfeld befindet.
Ich will das nicht als Gegenbeweis für das implicit motor learning verwenden, sondern auf ein Problem hinweisen. Wenn ich keine Anordnung finden kann, dass ich so etwas Einfaches wie eine höhere Trittfrequenz unterbewusst lerne, wie funktioniert das dann praktisch bei komplexeren Dingen?
Das „implicit motor learning“ beschreibt sich als eine Art Saat zum Bewegungslernen. Ich würde eher sagen, das „implicit motor learning“ ist eher eine Methode, um die Ernte des expliziten Bewegungslernens einzufahren.
Mir hat ein Lehrer beigebracht, bei Lagenwechseln über zwei gegriffene Töne, gezielt eine Pause, die einem rhythmischen Wert hat, einzuüben. Fügte aber des Öfteren hinzu, dass den Rest dann das Ohr regeln würde.
Diese Methode funktioniert dadurch, dass man bei ihr lernen kann, durch was für eine Bewegung der Ton endet. Irgendwann greift der Klangwunsch ein und platziert die Bewegung so, sodass die Lücke zwischen den beiden Lagenwechseltönen kleiner wird.
Voraussetzung ist, dass man den Zusammenhang Tonende und Bewegung mitbekommt. Das kann vielleicht sogar unterbewusst sein. Die weitere Voraussetzung ist, einen Klangwunsch zu haben.
Mancher wird sich wundern, warum ich Klangwunsch statt Klangvorstellung schreibe. Eine Klangvorstellung ist motivationspsychologisch neutral, der Klangwunsch nicht.
Also wir sammeln beim Üben Erfahrungswissen, was sich dann im Unterbewusstsein zurechtrückt oder stimmig gemacht wird. Wenn manche Dinge einfach nicht funktionieren wollen, einfach nur spielen und abwarten, was passiert.
In meiner Übeerfahrung kenne ich solche Effekte, und glaube, das erfahrene Über diese auch kennen.
Der Beitrag wurde am Freitag, den 14. März 2025 um 08:11 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Gitarre lernen, Gitarrenunterricht, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .